
Isabel Marant hat eine, G‑Star hat eine, wie auch Balenciaga (Foto), Hugo Boss, Sandro, AMI, Aigle oder Zara, H&M und nun auch sogar Shein. Die Rede ist von einer Website für Secondhand-Ware. Das Engagement geht über alle Genres – von Ultra-Fastfashion bis Luxus. Das Geschäft mit gebrauchter Mode wird auch für Brands mehr und mehr zum Muss. Vor allem aus PR-Gesichtspunkten kann es sich eine Marke heute kaum noch leisten, innerhalb ihrer Nachhaltigkeits-Strategie das Preloved-Business auszuklammern. Weil es ein Baustein ist, um in der Circular-Economy mitzuspielen, weil sich damit die Chancen erhöhen, als B‑Corp eingestuft zu werden, weil sich damit neue Käuferschichten gewinnen lassen, weil damit eine zusätzliches Preiskategorie ins Sortiment eingebaut werden kann, und weil dieses zusätzliche Segment das Gesamt-Angebot um eine gewisse Uniqueness bereichert. Was in der Liste der Argumente fehlt, ist allerdings das Thema Geld-Verdienen. Denn: So toll es klingt, im Secondhand-Business mit dabei zu sein, rentabel ist es bisher (meist) nicht.
Als mich vor rund zwei Jahren eine Vertreterin eines deutschen Modeanbieters fragte, ob sie als Brand in den Markt der gebrauchten Mode einsteigen sollte, kam meine Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Ja, auf jeden Fall und am besten sofort.“ Heute allerdings, nach Gesprächen mit Akteuren dieses Business‘, eigenen Erfahrungen als Secondhand-Händlerin, zahlreichen Selbstversuchen als Kundin und noch mehr journalistischen Recherchen in diesem Segment würde ich die Frage zwar noch immer bejahen, aber trotzdem zur Vorsicht raten. Bevor man sich als Brand engagiert, sollte klar sein, wie, mit welchem Ziel, mit welcher Ware und mit welchem Partner man den Eintritt in dieses Geschäftssegment plant. Es gibt längst nicht mehr nur einen einzigen Weg, sondern Dutzende:
Will man als Marktplatz auftreten und die Abwicklung den Konsumenten überlassen, also die Peer-to-Peer-Strategie fahren? Oder will man selbst als Akteur für Second-Ware auftreten? In Form eines Take-back-Modells? Will man nur Ware der eigenen Marke oder auch Fremdmarken anbieten? Wo wird die Abwicklung aufgehängt: komplett intern oder komplett outgesourct oder nur in Teilen outgesourct? Und wenn extern, welcher Partner ist dann der Richtige? Soll der Online-Auftritt inhouse entwickelt werden oder sollte man auf die Technik der neuen Secondhand-Tech-Start-ups vertrauen? Will man lokal oder international auftreten? Die Gebrauchtware nur online oder auch in den Läden anbieten? Und zum Schluss noch mal ganz konkret: Wer sammelt, wer sortiert, wer wäscht, bügelt, repariert, fotografiert, wer stellt es online/offline, wer verkauft, was ist mit Retouren und wohin mit der Ware, die nicht verkauft werden kann?
Ob das Re-Commerce-Business für billige Fast Fashion überhaupt Sinn macht, ist diskutierbar.
Die Menge der Fragen (und das sind längst nicht alle) zeigt schon, dass der Einstieg in den Re-Commerce nicht mal so nebenher von der Marketing‑, Vertriebs- oder der CSR-Stabsstelle geleistet werden kann. Dafür ist das Business zu komplex, der Abwicklungs-Aufwand zu gewaltig und auch der mögliche Imageschaden beim Scheitern zu groß. Jede Firma muss sich klar sein: Über einem marken-initiierten Secondhand-Angebot schwebt beim Konsumenten grundsätzlich der Vor-Verdacht des Greenwashings und die Frage: Wie ernst meinen es die Unternehmen wirklich mit der Mode aus zweiter Hand?

Das Beispiel Shein zeigt, wie man es nicht machen sollte: „Shein Exchange“ heißt der Service, der zwar publikumswirksam verlautbart wurde, aber auf der Website nirgends zu finden ist und nur über die App erreichbar sein soll. Doch auch hier führt der QR-Code der Werbung nur zur normalen Neuwaren-Verkaufsplattform. Der auf der Ankündigung sichtbare Button „Exchange“ fehlt im Menu und wird angeblich erst nach der Registrierung sichtbar. Spätestens hier hat mich Shein als Secondhand-Klient verloren, denn ich will den Chinesen auf keinen Fall meine E‑Mail mitteilen oder ein Kundenkonto eröffnen. Ob sich nach der Registrierung wirklich ein Online-Angebot gebrauchter Shein-Ware öffnet oder nicht, kann ich nicht sagen. Für mich als Konsument endet die Erfahrung beim billigen Trick, mich auf diese Weise als Neukunden ködern zu wollen.
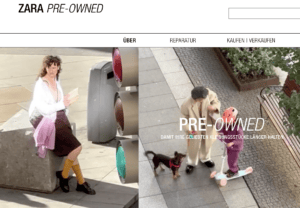
Sehen wir zu Zara, die es viel schlauer anstellen: Der Spanier sammeln Altware ausschließlich für Spenden ein. Auf der Website steht: „Alle gesammelten Kleidungsstücke werden an lokale Organisationen übergeben […], um deren bestmöglichen Zweck zu bestimmen. Sie werden beispielsweise an von Ausgrenzung bedrohte Menschen gespendet, in Secondhand-Läden verkauft oder recycelt.“ Als Partner werden die Deutsche Kleiderstiftung, Caritas, le Relais etc. genannt. Zara tritt hier auf als verantwortungsbewusste Alternative zu Kleidercontainern, die in den vergangenen Jahren mehr und mehr in Verruf kamen. Das geldwerte Geschäft mit der Secondhand-Ware überlässt Zara generös seinen Kunden, für die es den firmeneigenen Marketplace „Pre-owned“ zur Verfügung stellt, auf dem sich Verkäufer und Käufer unter sich und ohne jegliche Provision oder Gebühren einigen können.
Ob das Re-Commerce-Business für billige Fast Fashion überhaupt Sinn macht, ist ohnehin diskutierbar. Das weiß auch H&M, die als einer der Pioniere im Secondhand gelten und sich längst nicht mehr nur mit der eigenen Ware zufriedengeben. Bei „Preloved H&M“ gibt es auch Etro, Max Mara, Ganni, Chloé und viele andere mehr zu kaufen – neben den Schwesterbrands wie Arket, COS, &Other Stories und einer speziellen Kooperation mit der eigenen Secondhand-Tochterfirma Sellpy.
Auf Partnerschaften mit erfahrenen Resale-Spezialisten setzen auch manche Luxusmarken, um die eigene Brand „sauber zu halten“ und dennoch in der Kreislaufwirtschaft mitzumischen. So kooperiert Burberry seit Jahren erfolgreich mit Vestiaire Collective, die inzwischen auch für bekannte Händler wie Mytheresa oder LuisaViaRoma die Abwicklung des Resale-Services übernehmen. Aus solchen strategischen Zusammenschlüssen können Win-Win-Situationen entstehen.
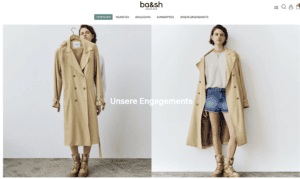
Andere schaffen es aber auch allein, aus dem unrentablen Circular-Economy-Segment eine Erfolgsgeschichte zu stricken. Bestes Beispiel ist die französische Marke Ba&Sh: Die Pariser stiegen im Rahmen einer umfangreichen Nachhaltigkeitsstrategie 2021 ins Secondhand-Geschäft ein. Bei der Abwicklung setzte Ba&Sh auf externe, spezialisierte Serviceunternehmen, erst Reflaunt, jetzt Faume. Laut eigenen Aussagen konnten im Jahr 2023 insgesamt 20.000 gebrauchte Kleidungsstücke wieder in den Kreislauf gebracht werden. Das Secondhand-Business trägt inzwischen fünf Prozent zum Gesamtumsatz der Firma bei und war einer der ausschlaggebenden Punkte dafür, dass Ba&Sh im Juni 2024 als B‑Corp zertifiziert wurde. Das Engagement der Marke für gebrauchte Mode zahlte sich also aus: im Image und im Umsatz.
Solche Beispiele machen Mut – trotz der genannten hohen Einstiegshürden. Ich für meinen Fall bin noch immer der Meinung, dass das Geschäft mit gebrauchter Mode Zukunft hat und jeder, der noch nicht mitmischt, Gefahr läuft, einen wichtigen Trend zu verpassen.