
Designer auszuwechseln, ist ein übliches Mittel, um eine in die Jahre gekommene oder auch strauchelnde Luxusbrand wieder zurück ins Licht zu führen. Doch aktuell strauchelt nicht nur eine Brand, sondern ein ganzes Genre. Der Luxus hat Glamour und vor allem Umsatz verloren. Skandale um schlechte Qualität, Ausbeutung in der Produktion und unziemliche Geschäfte mit Russland haben das Vertrauen in das Edel-Genre der Mode erschüttert. Dazu kommen Vorwürfe einer greedflation, einer „der Gier geschuldeten Inflation“ seitens der großen Marken. Beim Streben nach immer mehr Profit sind die Preise zu stark angehoben worden und weder durch innovatives Design noch beste Qualität gerechtfertigt.
Es war also höchste Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Neue Köpfe sollen es richten. Ein Dutzend Maisons haben für die kommende Sommersaison 2026 ihren Kreativdirektor ausgetauscht. Dazu gesellen sich zwei Häuser, die bereits zu den Herrenschauen, bzw. zur Haute Couture den Wechsel vollzogen haben und nun eine Premiere bei der Womenswear feiern. So viele Neuzugänge auf einmal gab es noch nie. Genau deshalb sprach man im Vorfeld von der „Fashionweek des Jahrzehnts“. Die Neuen:
- Rachel Scott bei Proenza Schouler
- Demna bei Gucci
- Simone Bellotti bei Jil Sander
- Louise Trotter bei Bottega Veneta
- Dario Vittale bei Versace
- Jonathan W. Anderson bei Dior
- Pier Paolo Piccioli bei Balenciaga
- Jack McCollough und Lazaro Hernandez bei Loewe
- Miguel Castro Freitas bei Mugler
- Mark Howard Thomas bei Carven
- Duran Lantink bei Jean Paul Gaultier
- Matthieu Blazy bei Chanel
- Glenn Martens feierte Womenswear-Premiere bei Margiela
- Michael Rider bei Celine
Die Energie stimmte, und so machte es seit langer Zeit endlich wieder Spaß, dieser Fashionweek-Saison zu folgen.
Am Dienstag ging dieser hoch erwartete Modewochen-Reigen in Paris zu Ende. Haben sich die hohen Erwartungen erfüllt?
Meine Antwort lautet: Ja. Dank der hohen Konzentration von Premieren, aber nicht nur allein deswegen. Umbrüche und ein Umdenken waren an vielen Stellen zu erkennen. Diese Modewoche war geprägt von einer Kritik von innen, einer Demokratisierung der Fashionweeks von außen, neuen Formaten, Ideen und Innovationen, einer Rückkehr der Kollektionsbesprechungen – plus eben den angekündigten Debüts im Dutzend.

Die Energie stimmte, und so machte es seit langer Zeit endlich wieder Spaß, dieser Fashionweek-Saison zu folgen. Ein Event jagte das Nächste. Dazwischen überraschten die Designer mit harscher Kritik an ihrer eigenen Branche: Yohji Yamamoto zeigte sich mit einem Stinkefinger auf dem Cover von Business of Fashion und wetterte los: „Das Fashionbusiness wird verschwinden.“ Das Handwerk sterbe aus, Billigmode zerstöre den Erhalt von Know-how.
Glenn Martens, heute Designer bei Diesel und Maison Margiela, verglich die Modewoche mit den tödlichen Spielen „Hungergames“ aus dem Roman „Die Tribute von Panem“, einer dystopischen Romanreihe von Suzanne Collins. Designer hätten heute die Aufgabe, mit einer Show das Internet zum Explodieren zu bringen, Entwürfe müssten klickfähig sein, aber niemand frage mehr nach dem Savoir-faire oder der kreativen Arbeit.
J.W. Anderson, neu bei Dior, erklärt zu seiner ersten Dior-Show, dass ein „Einschließen in die Historie eine Implosion“ verursache und dass „ein Wechsel unvermeidbar sei“.
Zu guter Letzt verkündet der neue Chanel-Designer Matthieu Blazy, dass die Mode ihre Narrative überdenken muss: „Luxus genügt nicht mehr. Er ist teuer und rar, aber reicht das? Nein, das reicht nicht.“
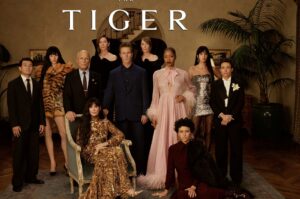
Dema hielt sich gar nicht lange erst mit großen Reden auf, sondern veröffentlichte seine See-now-buy-now-Gucci-Entwürfe auf Instagram. Zum Start in Mailand gab es für das Promi-besetze Publikum noch einen launigen Film zu sehen, den Gucci gleichzeitig ins Internet stellte – für jedermann sichtbar und zur gleichen Zeit.
Glenn Martens hatte ebenfalls genug von elitären Modenschauen und verteilte seine Diesel-Kollektion über ganz Mailand. Vor Kirchen, Bars, Kiosken und U‑Bahn-Stationen posierten Models in Plexiglas-Eiern vor den Passanten. Bei Carven, eine der wenig beachteten Premieren dieser Saison, führte ein Teil des Catwalks ins Freie und an der Absperrung für die nicht eingeladenen Zuschauer entlang.
Den größten Medienhype aber vereinte „La Watchparty“, eine Art Public-viewing von Modenschauen nach dem Vorbild großer Fußball-Events. Die schräge Idee stammt von Elias Medini, besser bekannt unter seinem Pseudonym Ly.as. Der Franzose gehört zu einer neuen Generation von Social-media-Modekritikern, die auf Instagram und TikTok die Kollektionsbesprechungen wiederbeleben, die seit dem Niedergang der Blogger gegen 2015 weitgehend verschwunden waren.

Veränderung war also an vielen Stellen zu spüren. Die vielen, hochkarätigen Premieren bildeten dabei die Spitze des Eisbergs, in dem sie einen Schlusspunkt hinter zahlreiche Äras setzten: Acht Jahre war Maria Grazia Chiuri für Dior tätig, zehn Jahre Demna bei Balenciaga, zwölf Jahre J.W. Anderson bei Loewe. Virginie Viard bei Chanel war nie ihr Image als Interims-Designerin losgeworden, das Haus suchte weiter nach einem Nachfolger für den verstorbenen Karl Lagerfeld. Und bei Jean Paul Gaultier ging es um nichts Geringeres als die Rückkehr in die Prêt-à-Porter nach einer langen Pause.
Die Zahl der Premieren war so groß, dass man sich kaum mit einer allein aufhalten konnte. Es entstand eine Art Konkurrenz untereinander: Welche Debütkollektion war am meisten gelungen? Welche entsprach am besten der DNA des Hauses? Welche Kollektion lieferte die größten Innovationen? Die von Matthieu Blazy bei Chanel oder doch eher Pier Paolo Piccioli bei Balenciaga? Was ist mit Louise Trotter bei Bottega Veneta oder J.W. Anderson bei Dior? Fast jeder, der diese Saison verfolgt hat, kann einen anderen Favoriten nennen.

Mehr Übereinstimmung gibt es am unteren Ende: Über Duran Lantink‘s Debüt bei Jean Paul Gaultier herrschte weitgehend Unverständnis. Der Niederländer, wie Gaultier als enfant terrible bekannt, wollte eine „Distorsion der Klassiker und eine Zelebration der Überraschungen“. Dies ist ihm geglückt. Ob diese Kollektion jedoch ein Kassenschlager wird, ist stark zu bezweifeln.
Die alte Management-Strategie des Designerwechsels funktioniert noch immer bestens.
Allen SS2026-Premieren ist gemein, dass sie für sehr viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt haben. Die alte Management-Strategie des Designerwechsels funktioniert also noch immer bestens. Und zwar so gut, dass die Masse der Premieren diese Saison alles überstrahlte. Zum Leidwesen der anderen. Wer könnte aus dem Stand heraus sagen, wie die Kollektion dieses Saison bei Chloé, Dolce et Gabbana, Burberry, Missoni, Calvin Klein oder Stella McCartney aussieht? Wer weiß schon, dass Pieter Mulier bei Maison Alaïa, Séan McGirr bei Alexander McQueen und Miuccia Prada zusammen mit Raf Simons für Prada tolle Kreationen abgeliefert haben? Schon eher im Gedächtnis ist, dass Heidi Klum als Braut bei Vivienne Westwood auftrat und dass bei Miu Miu nun Küchenschürzen im Trend liegen.

Doch selbst dieser Gossip zeigt, dass sich etwas in der Mode verändert. Dass mit dieser Saison ein Aufbruch in Gang gesetzt wurde, der sich hoffentlich über die kommenden Jahre weiterspinnen wird. Dass die Mode wieder mehr auf ihr Produkt schaut und weniger auf die Front-row und dass Kollektionen uns wieder in den Bann versetzen können.
So gesehen waren diese Modewochen vielleicht tatsächlich die „Fashionweek des Jahrzehnts“.