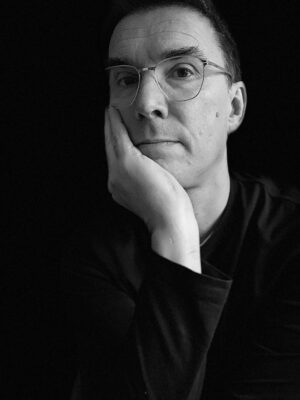
Patrick Cloppenburg zieht sich aus dem Verwaltungsrat der Schweizer P&C‑Muttergesellschaft zurück, ebenso seine Schwester Catharina. Die Familie gibt die Führung des Familienunternehmens aus der Hand. Stefano Della Valle übernimmt.
Dass die Nachricht zwei Tage nach der gescheiterten Übernahme von Sinn erfolgt, ist natürlich Zufall. So eine Entscheidung trifft man nicht über Nacht, auch wenn Patrick Cloppenburg eine andere Dramaturgie im Sinn gehabt haben wird. Seit der erfahrene Warenhausmanager Della Valle als Berater in Zug anheuerte, waberten die Gerüchte um einen bevorstehenden Führungswechsel in der Holding. Insofern kommt der Rückzug nicht völlig überraschend. Dem jüngsten Sohn des 2023 verstorbenen P&C‑Patriarchen Harro Uwe Cloppenburg wird ein eher wechselhaftes Interesse am operativen Handelsgeschäft nachgesagt. Aber auch wenn er jetzt keine offizielle Funktion mehr hat, bleibt er als Mehrheitsgesellschafter der starke Mann im Konzern.
Schwer vorstellbar ist zudem, dass Patrick Cloppenburg mit der Chef-Position seine Ambitionen fallen lässt. Dass es mit der Übernahme von Sinn nicht geklappt hat, ist sicher ein Rückschlag. Die Entscheidung der Gläubigerversammlung kam am Montag sehr überraschend. Dahinter steckt wahrscheinlich mehr ein Misstrauen gegenüber den P&C‑Absichten als ein Zutrauen in das Fortführungskonzept von Isabella Göbel. Die Pläne der alten und neuen Inhaberin stehen unter einem nicht unbedeutenden Finanzierungsvorbehalt. Denkbar, dass das letzte Wort in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen ist.
Der Bieterwettbewerb um Sinn ist vor dem Hintergrund der seit Jahrzehnten laufenden Konsolidierung des Multilabelhandels zu sehen. Patrick Cloppenburg sieht P&C dabei in der Rolle des Protagonisten. 2021 hat er bereits die dänische Department Store-Kette Magasin du Nord übernommen. Aktuell wird ihm Interesse an P&C Hamburg nachgesagt. Ob Nord-CEO Felix Schröder dem Erben des anderen Familienstamms den Triumph einer Wiedervereinigung der seit 1911 getrennt operierenden P&Cs gewähren wird? Das Manager-Magazin schreibt, dass die Düsseldorfer auch an PKZ in der Schweiz und an Breuninger dran sind. Die Verkaufspläne der Stuttgarter hatten die Branche im vergangenen Jahr geschockt. Laut Wirtschaftswoche sind die anfänglichen Bieter inzwischen größtenteils abgesprungen. Last but not least spekuliert man in Münchner Einzelhandelskreisen auch über ein Interesse P&Cs an Hirmer.
Den Fokus einseitig auf bessere Einkaufskonditionen zu legen, wäre kurzsichtig. Mehr noch als auf das letzte Prozent im Einkauf kommt es im Einzelhandel auf Kundennähe und Exzellenz im Verkauf an.
Die großen Bekleidungsfilialisten mit ihren Multilabelsortimenten gehörten mal zu den Stars der Zunft. Seit den 90er Jahren ändert sich das. Vertikalisierung und Digitalisierung haben den Raum für dieses Geschäftsmodell enger gemacht. Zara und H&M haben die Fußgängerzonen erobert. Der größte Kunde für die deutsche Bekleidungsindustrie ist mittlerweile Zalando. Dyckhoff, Boecker, Hettlage, Wehmeyer sind längst vom Markt verschwunden. Sinn ist mit Leffers fusioniert, nach dem zweiten von inzwischen vier Insolvenzverfahren hat man 2018 das „Leffers“ im Namen getilgt. Von den einstmals vier Warenhauskonzernen ist nur noch Galeria übrig. Wöhrl musste 2016 Insolvenz in Eigenverwaltung anmelden und wird seither vom Gründerenkel Christian Greiner geführt.
Das Multilabel-Business abzuschreiben, wäre dennoch falsch. Denn gleichzeitig mit dem Niedergang der einen, sind auf der anderen Seite neue familiengeführte Filialisten aufgestiegen. Allen voran Modepark Röther mit seinen inzwischen 54 großflächigen Stores. Peter Graf ist aus Österreich nach Deutschland expandiert und hat Appelrath-Cüpper übernommen. Aber auch Böckmann und Kaufhaus Stolz bringen es inzwischen auf eine stattliche Zahl an Läden.
Dass großflächige Multilabel-Formate weiter funktionieren können, beweisen zudem viele lokale Platzhirsche. Kundennähe, Individualität und kurze Wege zählen in diesem Marktsegment mehr als die Größenvorteile der zentral geführten Filialisten, die zudem meist mit erhöhter Komplexität einhergehen. Die Herausforderung ist, Größe im Einkauf mit Stärke im Verkauf zu verbinden. Daran arbeiten sich Handelsmanager in allen Filialsystemen ab.
Den Fokus einseitig auf bessere Einkaufskonditionen zu legen, was häufig die Haupt-Motivation hinter einer Fusion ist, wäre dabei kurzsichtig. Mehr noch als auf das letzte Prozent im Einkauf kommt es im Einzelhandel auf Kundennähe und Exzellenz im Verkauf an.
Ob Patrick Cloppenburg das auch so sieht? In diesem Punkt war P&C nämlich schon mal weiter.