Also wenn du mich das als Redakteur eines Wirtschaftstitels fragst, dann muss ich mir die Brille ganz nach oben auf die Nase rücken und nach einem Kurz-Studium der jüngsten Quartalszahlen der großen Luxuskonzerne sagen: Also früher war definitiv mehr Lametta, vor allem in China. Eine Entwicklung allerdings, die sich nach dem kurzzeitigen Nachhol-Hoch zum Corona-Ende bereits einige Zeit in den Umsatzzahlen der LVMHs, der Richemonts, der Kerings, Cotys und vielen anderen widerspiegelt. Mal nur vorübergehend, mal mehr und mal weniger. Deshalb ja auch seit Monaten die endlosen Personalrochaden, weil der Glaube nicht totzukriegen ist, dass die ausgebrannte Elf mit dem richtigen Trainer doch noch den reichlich angelaufenen Pokal holt. Vor applausmüdem Publikum. Das mag in Einzelfällen funktionieren, meist dürfte der Effekt aber dem Wechsel des Deutsche-Bahn-Chefs gleichen.
Persönlich glaube ich, dass es Lust auf Luxus immer geben wird. Und eben auch eine stetig neue Definition auf allen Einkommensstufen, was denn der Begriff individuell bedeutet. Im Park in der Sonne auf einer Bank sitzen mit einem guten Buch. Das erste verlorene Kilo beim intermittent fasting. Die Bottega-Tasche, die es endlich auf Vestiaire Collective zum Unter-Kleinwagen-Preis gab. Der letzte Aperol auf der Terrasse ohne Fleecedecke. Von mir aus auch der dritte Bentley, die fünfte Yacht und das siebte Chalet in Gstaad. Whatever floats your boat.
Die Unteren wie die Oberen Zehntausend begreifen aber, glaube ich, mehr und mehr, dass Luxus ist wie Autismus: ein Spektrum. Und damit will ich keine ernste Erkrankung verharmlosen, ich habe als Zivi verschiedenste Menschen mit dieser und anderen Behinderungen betreut. Weshalb ich auch, anders als der US-(Un-)Gesundheitsminister recht gut weiß, wie wenig irgendeine Windpockenimpfung mit diesem Schicksal zu tun hat.
Wenn sich für Tupperware bald letztmalig der Plastikschüsseldeckel schließt, warum sollte das nicht auch viel weniger nützlichen Designermarken passieren?
Und dieses Luxus-Spektrum macht die Ansprache recht diffizil und teuer, will man möglichst allen gefallen. Was Häuser mit großen Volumina und daraus resultierendem Abverkaufsdruck halt müssen, während Einhörner wie Hermès erfolgreich ruhigere Kugeln polieren und schieben dürfen.
Nimmt man dazu, dass gerade jüngere Generationen zwar durchaus empfänglich sind für die Reize von Gold, Silber, Swarovski-Kristalle und Nappaleder, nur leider größtenteils in eine viel ungewissere und vermutlich weniger liquide Arbeits- und Konsumzukunft steuern, dann ist der Glanz vielleicht noch da – bloß weniger erschwinglich und verlockend. Wen wundert es, dass Chinas Jugend verstärkt auf „less is more“, günstige Start-up-Marken und heimische Newcomer setzt.
Wer glaubte, dass nur weil eine Maison hundert oder mehr Jahre auf dem Logo hat, sich diese glorreiche Vergangenheit inmitten einer globalen Tech-Revolution und makroökonomischer Wirbelstürme auf weitere 100 Jahre verlängern ließe, sollte weniger Lagerfeld-Biografien lesen. Wenn sich für Tupperware bald letztmalig der Plastikschüsseldeckel schließt, warum sollte das nicht auch viel weniger nützlichen Designermarken passieren?
Vielleicht liegt darin denn auch eine Hoffnung, dass Luxus einen Weg zurück aus astronomischen, jährlich gnadenlos weiter ausgereizten Aufwärts-Preisspiralen findet zu einem ehrlichen Mehrwert bei Ästhetik, Handwerk und transparenter Genese. Denn schwarze Nylontaschen aus China in Italien mit einem kleinen Lederflicken versehen und zu Margen zu verkaufen, die selbst Dagobert Duck die Schamesröte auf den Entenschnabel treiben würden, das ist sicherlich kein Rezept für übermorgen.
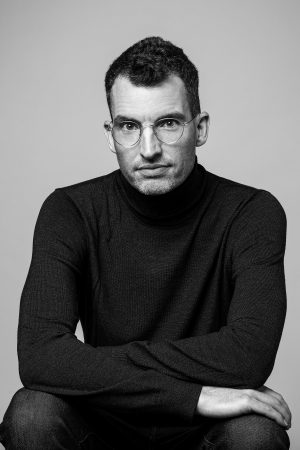
Siems Luckwaldt ist seit rund 20 Jahren ein Experte für die Welt der schönen Dinge und ein Kenner der Menschen, die diese Welt möglich machen. Ob in seinem aktuellen Job als Lifestyle Director von Capital und Business Punk, für Lufthansa Exclusive, ROBB Report oder das Financial Times-Supplement How To Spend It.